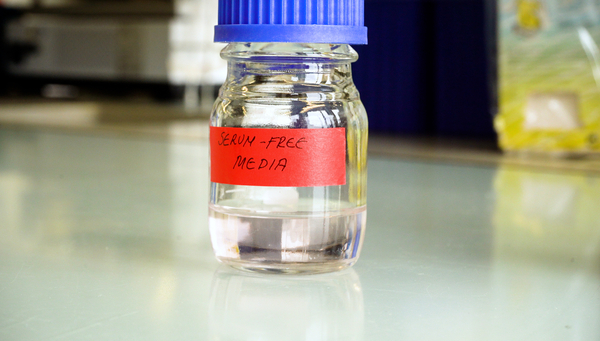News
Nahrungsumstellung für Zellkulturen
19. August 2025 |
«Ein wichtiges Thema unserer Forschungsgruppe ist es, Alternativen zu Tierversuchen zu finden», erklärt Kristin Schirmer, Gruppenleiterin in der Abteilung Umwelttoxikologie am Wasserforschungsinstitut Eawag. Eine solche Alternative ist der Einsatz von Kiemenzellen anstelle von lebenden Fischen bei Toxikologietests. Eine letzte Hürde, um diese Tests zukünftig komplett ohne tierische Produkte durchführen zu können, ist allerdings das Medium, in welchem diese Zellen gezüchtet werden müssen. In der Forschung mit Zellkulturen ist fötales Kälberserum (FKS) das weitverbreitetste Medium – eine nährstoffreiche Mixtur, welche – wie der Name bereits sagt – aus dem Blut von Kälberföten stammt. «Das Serum wird in einem inhumanen Prozess gewonnen», so Barbara Jozef, Forscherin an der Eawag. Daher ist es den Forscherinnen und Forschern ein Anliegen, möglichst darauf zu verzichten. Bereits sind am Markt diverse serumfreie Alternativen verfügbar, doch keines davon lässt sich für Fischzellen nutzen.
Ein langer Weg
Ihre Suche nach einer für Fischzellen geeigneten Alternative begann Jozef damit, herauszufinden, was Fischzellen für ihr Wachstum benötigen. Dazu trug sie alle Studien zu den Bedürfnissen von Regenbogenforellen und anderen Fischen zusammen, um die Basis für erste Tests zu legen. Doch das waren zu viele Parameter und Nährstoffkombinationen, um sie einzeln im Ausschlussverfahren zu testen. Um die Analyse zu beschleunigen, entwickelte Jozef eine neue Methode zur Quantifizierung der Zellproliferation. Die Methodik wurde zu einem wichtigen Instrument für die weitere Forschung von Jozef und trug dazu bei, dass einem ihrer Masterstudenten die ETH-Medaille verliehen wurde und sie selbst den Young Researcher Prize des Kosmetikunternehmens LUSH erhielt.
Sobald die Eawag-Forschenden herausgefunden hatten, was die Fischzellen brauchen und was FKS offenbar bietet, bestand die nächste Herausforderung darin, die FKS-Komponenten durch Alternativen zu ersetzen. Das Team wählte sorgfältig Vitamine, Mineralien, Hormone, Wachstumsfaktoren und Lipide aus, um die erforderlichen Wachstumsbedingungen zu schaffen, und minimierte dabei, wo immer möglich, tierische Komponenten. Der Prozess war alles andere als einfach, erforderte mehrere Anläufe und ständige Anpassungen und führte immer wieder zu unerwarteten Rückschlägen. «Wenn ich eine Lehre aus dieser Erfahrung ziehe, dann die, dass echte Innovation in der Wissenschaft selten nach einem festen Zeitplan abläuft. Stattdessen entstehen die grössten Durchbrüche, wenn wir uns die Zeit nehmen, Dinge in Frage zu stellen, zu scheitern und über unser eigenes Fachwissen hinauszugehen», reflektiert Jozef.
Als das neue Medium feststand, folgte der Härtetest. «Wir gewöhnten die Fischzellen an das neue Medium, indem wir die Menge an FKS bei jedem Medienwechsel reduzierten, bis die Zellen ganz ohne FKS wachsen konnten», erklärt sie. Doch nicht allen Zellen war dieser sanfte Übergang vergönnt, wie Jozef berichtet. «Sink or Swim» heisst die andere Methode, die Jozef und ihr Team nutzten. Dabei werden die Zellen ohne Angewöhnung ins neue Medium transferiert. Zur grossen Freude des Teams hielten sich auch diese Zellen wacker. Dennoch konnten sie Unterschiede beobachten. Jene Zellen, die langsam an das neue Medium gewöhnt wurden, benötigten zwar länger, um sich anzupassen, wuchsen dann aber nach einigen Zellteilungen schneller. Wohingegen es bei der «Sink or Swim» -Alternative am Anfang zwar schnell ging, sich dann aber das Wachstum verlangsamte. Doch egal, welche Methode angewendet wird: Das neue Medium funktioniert!
Nachmachen erwünscht
Jozef und ihr Team haben aber nicht nur nachgewiesen, dass das Medium funktioniert, sondern dass die so gezüchteten Kiemenzellen in flüssigem Stickstoff eingefroren und bei Bedarf wiederbelebt werden können – ein wichtiger Faktor in der Zellforschung. Jozef wird dieses neue Medium nun auch mit den Gehirnzellen von Regenbogenforellen testen. «Unsere Ergebnisse sollen andere Forschende ermutigen, unser Vorgehen und evtl auch das Medium für ihre eigenen Zelllinien zu adaptieren», sagt sie. «Damit wäre ein wichtiger Schritt zur tierfreien Forschung getan.» Ebenfalls hofft sie, dass die Industrie demnächst mehr Alternativen zu tierischen Komponenten für die Medien bietet. «Wir können nur testen, was am Markt verfügbar ist». Denn bis auf eine Ausnahme sind alle Komponenten des neuen Mediums ohne tierische Bestandteile. Nur ein Protein ist noch tierischen Ursprungs: da die Fischzellen in Tests schlecht auf Alternativen reagierten, enthält das neue Medium noch kleine Mengen des Rinderserums Albumin (nicht zu vergleichen mit FKS), da es für die Zellen schwierig ist, dieses Protein selbst zu bilden.
Die Industrie als Hoffnungsträger
Was derzeit am Markt verfügbar ist, limitiert nicht nur die Möglichkeiten im Labor. Das neue Medium, das nun alle selbst im Labor herstellen können, hat auch seinen Preis: Im Vergleich zum fötalen Kälberserum sind Alternativen immer noch teuer. Aber auch das werde sich vermutlich ändern. Jozef hofft dabei auf sinkende Preise bei steigender Nachfrage. Vor allem die Forschung im Rahmen von im Labor gezüchtetem Fleisch ist hier ein starker Treiber von neuen Produkten, die auf den Markt kommen und auf welche auch die Forschenden zurückgreifen könnten. Da FKS in der Lebensmittelindustrie verboten ist, dürfen die Zellen von Laborfleisch nicht in einem solchen Serum herangezüchtet werden. So investieren die entsprechenden Unternehmen stark in die Entwicklung von serumfreien Alternativen. Dass das möglich ist, hat das Team der Eawag auf jeden Fall gezeigt.
Titelbild: Das neue Medium kommt ohne das von Kälberföten gewonnene Serum aus (Foto: Leonardo Biasio, Eawag).
Originalpublikation
A systematic approach towards long-term, serum-free cultivation of fish cells with the RTgill-W1 cell line as example Barbara Jozef, Zhao Rui Zhang, Hans-Michael Kaltenbach, Kristin Schirmer