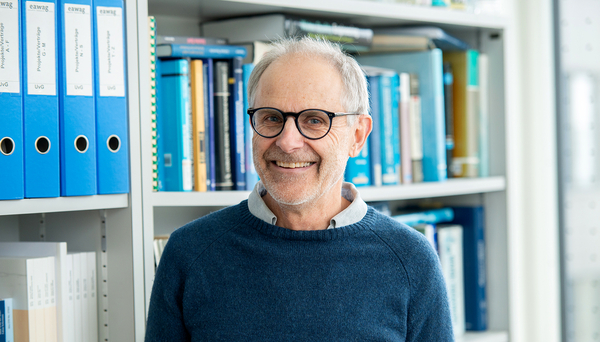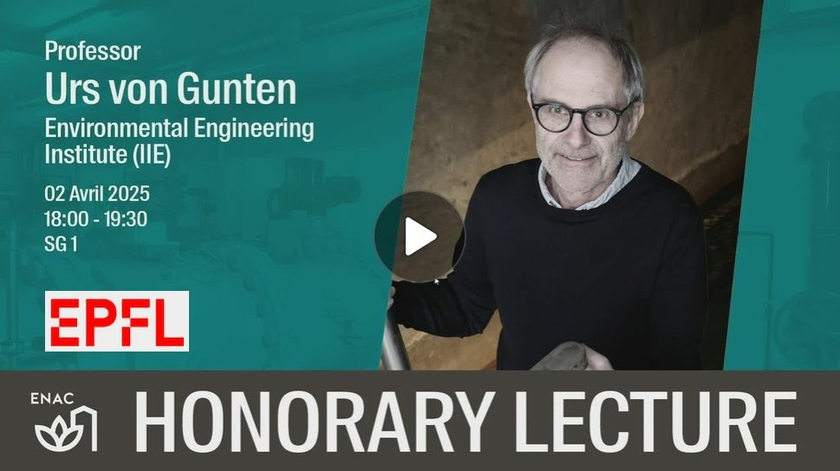News
Wasserchemiker Urs von Gunten geht in Pension
8. Mai 2025 |
Wäre er Schauspieler, würde wohl ein Oscar bei ihm im Wohnzimmer stehen. Für Forschende sind die Ehrungen nicht so medienwirksam. Doch die Liste der Auszeichnungen liest sich bei Urs von Gunten zumindest für Insider ebenfalls gut und liesse sich fast beliebig erweitern, siehe sein CV: Honor Award for Scientific Excellence of the Environmental Chemistry Division of the American Chemical Society, Sandmeyer Award of the Swiss Chemical Society, ACS Award for Creative Advances in Environmental Science and Technology, 3 Harvey Rosen Awards of the International Ozone Association, Thomson Reuters Highly Cited Researcher etc.
Auf der richtigen Seite der Wissenschaft
«Die Leute möchten immer wissen, woran ich forsche», sagt von Gunten in einem Gespräch an der EPFL schmunzelnd. «Aber das ändert sich sofort, wenn ich beginne ins Detail zu gehen.» Nach Abschluss des Diplom-Studiengangs Chemie an der ETH Zürich baute sich von Gunten einen Ruf als internationale Koryphäe im Bereich der Wasseraufbereitung auf. Er arbeitete an der Entwicklung von Oxidations- und Desinfektionsprozessen mit, die heutzutage in der Trinkwassergewinnung und in der Abwasserbehandlung als Standardverfahren gelten. Mit seinen Forschungsschwerpunkten steht er eindeutig auf der «richtigen Seite» der Wissenschaft: Auch wenn wir den unbeschränkten Zugang zu Trinkwasser in vielen Teilen der Welt als selbstverständlich erachten, müssen die Verfahren, die Wasser zu Trinkwasser machen, noch weiter verbessert werden.
Anerkannte Grösse in Asien
Genau das steckt hinter dem Erfolg von Guntens. Dass er sich nicht mit Publikationen in renommierten Journalen und Ehrungen zufriedengab und -gibt: Die Forschung muss Wirkung zeigen in der Praxis. Darum hat sich der Chemiker ab den 2000er Jahren stark engagiert in der Zusammenarbeit mit China. Da ist er populär, auch dank der Übersetzung seines Ozonbuchs auf chinesisch. Copy-paste in China? «Kein Problem», sagt von Gunten, «das war ja nicht gestohlen und zum Wohl der Menschen in China.» Und heute? «Schade, dass das Fenster eines offenen Chinas wieder geschlossen ist», sagt der Bald-Pensionär, «heute können wir auf Augenhöhe austauschen mit den Forschenden in China im Wasserbereich aber in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der künstlichen Intelligenz, müssen WIR heute wohl zu IHNEN gehen, um zu lernen, nicht umgekehrt.» Neben seinem Engagement in China hat Urs von Gunten auch eine langjährige Zusammenarbeit mit Forschenden in Südkorea etabliert. Obwohl Südkorea auf den ersten Blick sehr andersartig ist als die Schweiz, hat er rasch gemerkt, dass der Forschungsansatz und die Wissenschaftsethik in beiden Ländern sehr ähnlich sind.
Keine Angst vor politischen Aussagen
Der Exkurs zu China hat auch eine politische Note. Von Gunten scheut sich nicht, aus seiner Sicht verkehrte politische Narrative zu kritisieren. Etwa zu glauben, mit einigen Millionen Franken könne die Schweiz im globalen, Billionen-Wettstreit um digitale Fortschritte an der Spitze mitmischen. «Das ist absurd», sagt er, «besser sollten wir Nischen suchen, zum Beispiel an den Folgen der Digitalisierung für die Gesellschaft forschen, um die Menschen vor negativen Folgen zu schützen. Eine Eawag der Digitalisierung sollte das Ziel der Aktivitäten in diesem Bereich sein.» Auch der aktuell laufende Abbau in der Schweizer Umweltgesetzgebung lässt von Gunten nicht kalt. Werden zum Beispiel Zulassung und Monitoring im Bereich der Pestizide zurückgefahren, drohten jahrzehntelange Arbeiten an der Eawag geschwächt zu werden und eine Verschlechterung der Wasserqualität sowohl für Trinkwasser als auch für Ökosysteme.
Feinabstimmung ist Stärke der Wissenschaft
Droht eine Resignation bei engagierten Forschenden? «Nein», sagt Urs von Gunten, «kurzfristige Gewinnmaximierung und die Individualisierung der Gesellschaft sind globale Phänomene, und es war noch nie die Stärke der Politik, für komplexe Probleme komplexe Lösungen zu finden.» Daher gelte es heute erst recht, an diesen komplexen Problemen zu forschen und wissenschaftlich fundierte, fein abgestimmte Lösungen zu erarbeiten. Dazu müsse gesichert sein, dass sich die Forschung längere Zeit demselben Problem widmen kann. Das ist bisher im ETH-Bereich der Fall, aber wie die Entwicklungen zum Beispiel in den USA zeigen ist das nicht garantiert.
Sabbaticals, Querprojekte und Industrie-Praktikas als Schlüssel
Was garantiert, dass Forschung Wirkung hat? Für Urs von Gunten waren drei Sabbaticals an Universitäten im Ausland und mehr als 20 Sabbatical Gäste an der Eawag und EPFL entscheidend für neue Impulse. Aus der Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen und mit der Praxis wachse ein Verständnis, was «erforschbare Fragen» sind. Diese gelte es dann zu abstrahieren, damit «echte» Wissenschaft gemacht werden könne, zum Beispiel um Prozesse zu verstehen, die in Grossanlagen ablaufen, sagt er. «Für mich war ein Aufenthalt als ‘visiting scientist’ im zentralen Forschungslabor von SUEZ eine Schlüsselerfahrung. Anfangs war ich skeptisch. Aber ich begann die Sicht der Ingenieure und ihre Fragen zu verstehen. Das hat mir oft geholfen später.» Geholfen hat das auch der ganzen Eawag, etwa für eine gute Zusammenarbeit mit der Wasserversorgung der Stadt Zürich WVZ oder in Querprojekten über mehrere Abteilungen und zusammen mit Behörden und Praxis, wie Wave21 oder «Regionale Wasserversorgungen Basel-Landschaft 21» die er geleitet hat. Beides, die Gastaufenthalte in grossen Betrieben und Querprojekte, würde von Gunten an der Eawag am liebsten für obligatorisch erklären. «Akademische Messgrössen sind ok, aber es motiviert noch mehr zu sehen, wenn etwas umgesetzt wird.»
Titelbild: Peter Penicka, Eawag
Freitag, 9. Mai 2025, 14.00 Uhr bis 17.15 Uhr
Abschiedsveranstaltung für Urs von Gunten, Forum Chriesbach, Hörsaal C20
Programm [pdf]